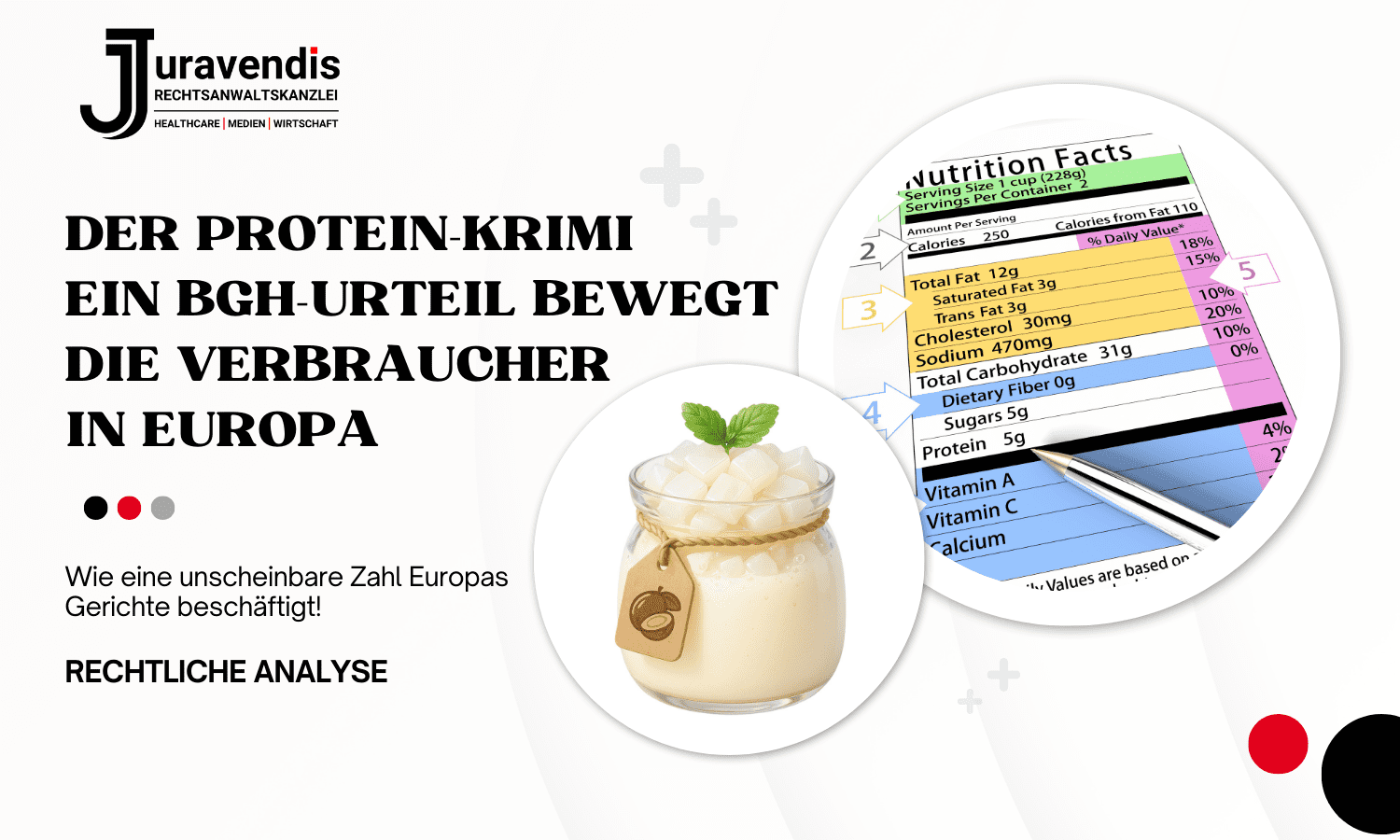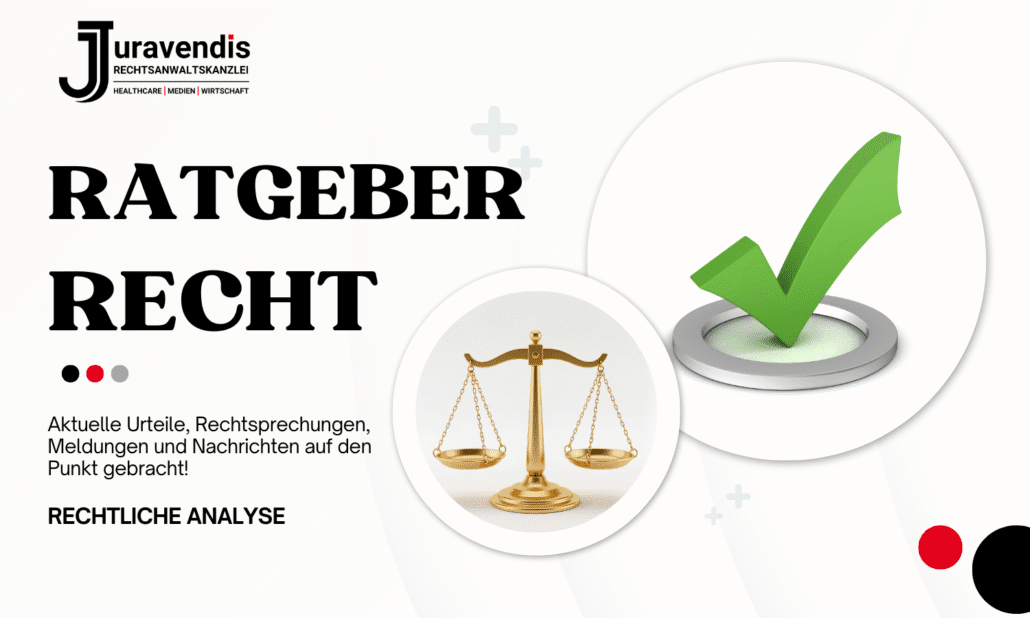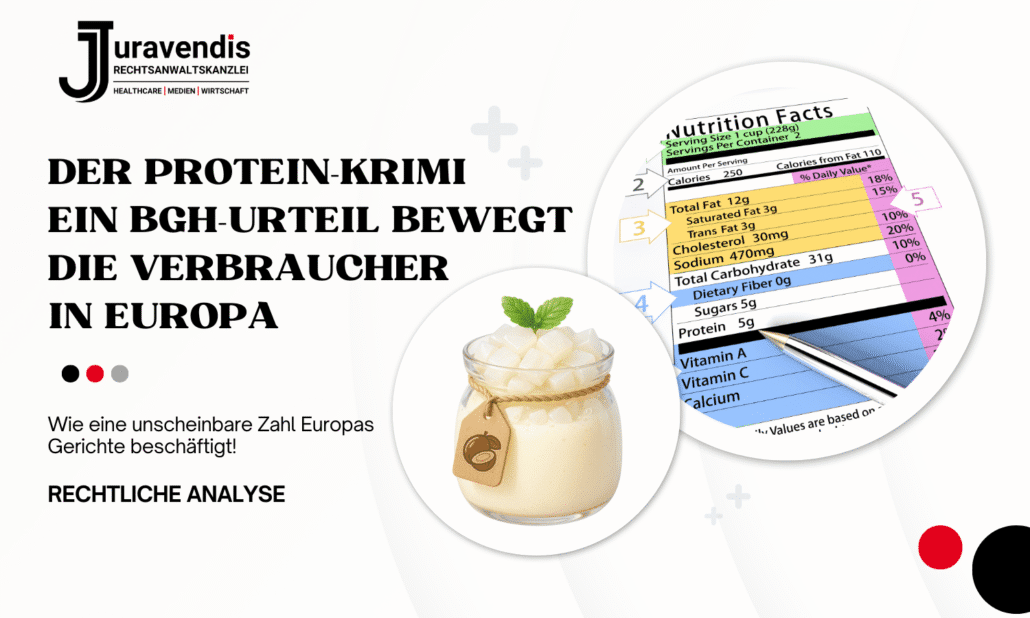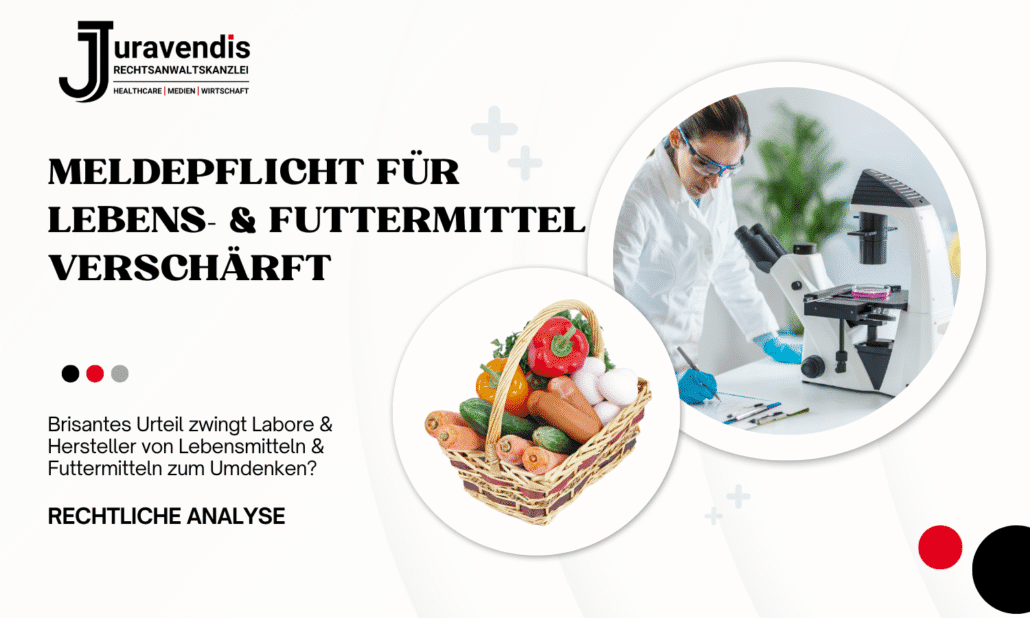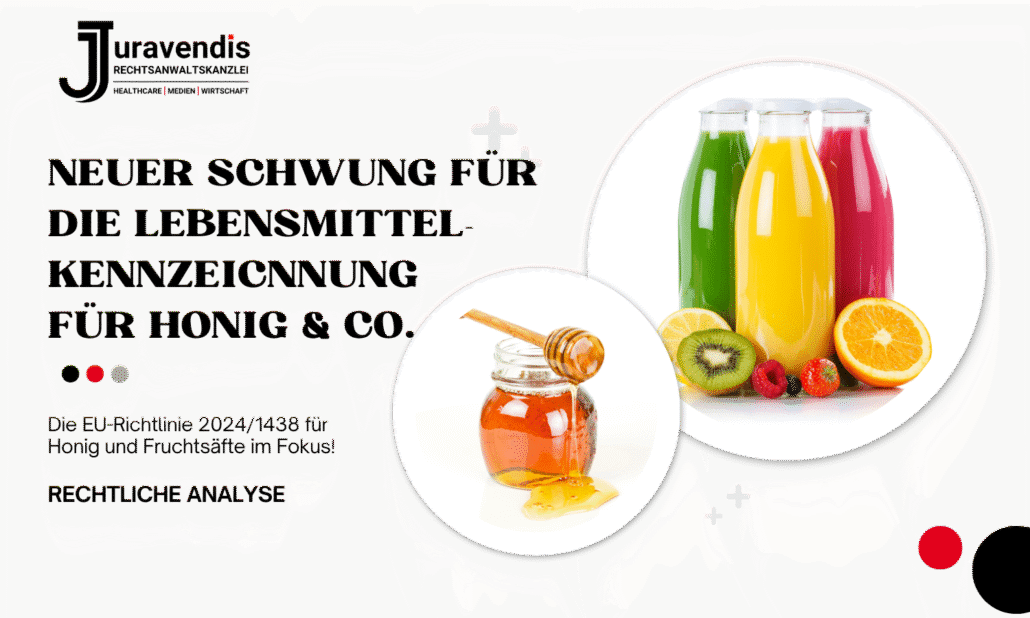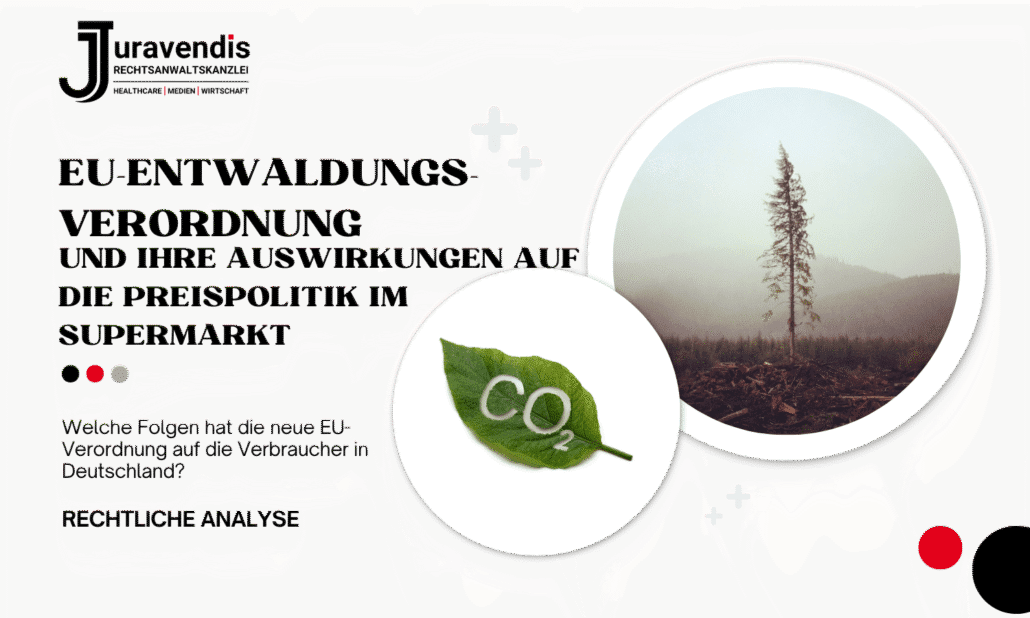Der Protein-Krimi: Warum „14g“ auf deinem Milchreis bald illegal sein könnte
Die unscheinbare Zahl, die Europas Gerichte beschäftigt
Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Supermarkt, der Einkaufskorb in der Hand. Ihr Blick fällt auf einen Becher Milchreis, der prominent mit „HIGH PROTEIN“ wirbt. Direkt daneben, unübersehbar in einem kleinen Kreis, steht die Angabe „14G PROTEIN“. Für die meisten von uns ist das eine willkommene, nützliche Information – klar, präzise und auf den Punkt gebracht. Sie hilft uns, eine schnelle Kaufentscheidung zu treffen.
Doch genau diese simple, faktisch korrekte Aussage ist Gegenstand eines hochkarätigen Rechtsstreits, der es bis vor Deutschlands obersten Zivilgerichtshof, den Bundesgerichtshof (BGH), geschafft hat. Dieses scheinbar winzige Detail hat ein juristisches Paradoxon geschaffen, das nationale Gerichte nicht lösen konnten. Sie sahen sich gezwungen, den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) anzurufen, damit dieser als ultimativer Schiedsrichter zwischen zwei widersprüchlichen europäischen Gesetzen entscheidet.
Dieser Fall ist weit mehr als nur ein Streit um einen Milchreis. Er enthüllt einen faszinierenden und fundamentalen Konflikt im europäischen Lebensmittelrecht. Es geht um die zentrale Frage: Welche Information hilft Verbrauchern wirklich – und welche könnte sie, allen guten Absichten zum Trotz, am Ende sogar in die Irre führen?
Die 4 überraschendsten Erkenntnisse aus dem „High Protein“-Urteil
Der Gerichtsfall ist juristisch komplex, doch er liefert einige verblüffende Einblicke in die Regeln, die unsere Lebensmittel im Regal bestimmen. Hier sind die vier wichtigsten Erkenntnisse.
1. Der verbotene Fakt: Warum eine simple Gramm-Angabe illegal sein könnte
 Im Kern des Streits steht ein Lebensmittelhersteller, der seinen Milchreis mit der Kombination aus dem Slogan „HIGH PROTEIN“ und der konkreten Angabe „14G PROTEIN“ bewarb. Dagegen klagte die Wettbewerbszentrale e.V., eine der führenden deutschen Selbstkontrollinstitutionen zur Durchsetzung des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb. Sie sah darin einen Gesetzesverstoß.
Im Kern des Streits steht ein Lebensmittelhersteller, der seinen Milchreis mit der Kombination aus dem Slogan „HIGH PROTEIN“ und der konkreten Angabe „14G PROTEIN“ bewarb. Dagegen klagte die Wettbewerbszentrale e.V., eine der führenden deutschen Selbstkontrollinstitutionen zur Durchsetzung des Rechts gegen unlauteren Wettbewerb. Sie sah darin einen Gesetzesverstoß.
Der Grund dafür liegt in Artikel 30(3) der EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV). Dieses Gesetz legt in einer sehr spezifischen und vor allem abschließenden Liste fest, welche Nährwertangaben freiwillig auf der Vorderseite der Verpackung wiederholt werden dürfen. Dazu gehören der Brennwert (Kalorien) sowie die Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz.
Der entscheidende Punkt: Protein (Eiweiß) steht bewusst nicht auf dieser Liste. Die Argumentation der Kläger und der Vorinstanzen ist daher glasklar: Die Wiederholung der Proteinmenge, selbst wenn sie zu 100 % korrekt ist, verstößt technisch gesehen gegen diese exklusive Regelung und ist somit unzulässig.
2. Gesetzes-Clash in Brüssel: Wenn zwei EU-Verordnungen kämpfen
Die Komplexität des Falls entsteht dadurch, dass hier zwei mächtige EU-Verordnungen aufeinanderprallen, die unterschiedliche Ziele verfolgen:
- Die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV): Ihr Ziel ist es, Verbrauchern standardisierte und umfassende Informationen zu liefern, vor allem über die verpflichtende Nährwerttabelle auf der Rückseite. Die Regel zur Wiederholung von Angaben (Art. 30 Abs. 3) soll verhindern, dass Hersteller sich nur die vorteilhaften Rosinen herauspicken und Verbraucher dadurch verwirrt werden.
- Die Health-Claims-Verordnung (HCVO): Ihr Ziel ist es, Werbeaussagen über die gesundheitlichen Vorteile eines Lebensmittels zu regulieren. Sie stellt eine Liste von vorab genehmigten Werbeslogans bereit – sogenannten „Claims“ wie eben „High Protein“ –, die Unternehmen verwenden dürfen, wenn ihre Produkte bestimmte Kriterien erfüllen.
Die clevere juristische Strategie des Herstellers besteht nun in einer Umdeutung: Er argumentiert, dass „14G PROTEIN“ keine verbotene Wiederholung einer Nährwertangabe (geregelt durch die LMIV) sei, sondern eine erlaubte Konkretisierung einer Werbeaussage (geregelt durch die HCVO). Dieser Konflikt ist so fundamental, dass selbst Fachexperten uneins sind. So vertritt der Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS) die Ansicht des Herstellers und sieht die Gramm-Angabe als zulässige Ergänzung des „High Protein“-Claims. Genau diese tiefe rechtliche Unsicherheit hat den BGH dazu bewogen, den EuGH um eine endgültige Klärung zu bitten.
3. Die überraschende Wahrheit: Was „High Protein“ für den Gesetzgeber wirklich bedeutet
Was macht ein Produkt für Sie zu einem „High Protein“-Produkt? Die meisten Menschen würden intuitiv antworten: die absolute Menge an Protein in Gramm. Doch die juristische Realität, wie sie in der Health-Claims-Verordnung (HCVO) definiert ist, sieht völlig anders aus.
Nach der EU-Verordnung ist die Angabe „hoher Proteingehalt“ nur dann zulässig, wenn der Proteinanteil mindestens 20 % des gesamten Brennwerts (also der Gesamtkalorien) des Lebensmittels ausmacht.
Aus Sicht des Gesetzes ist die absolute Gramm-Zahl für die Zulässigkeit der Werbeaussage irrelevant. Was zählt, ist das Verhältnis von Protein zu den Gesamtkalorien. Der Grund für diese relative Messgröße ist der Schutz vor „Kalorienbomben“. Ein Produkt könnte zwar viel Protein enthalten, aber gleichzeitig durch Unmengen an Zucker und Fett ernährungsphysiologisch unausgewogen sein. Die prozentuale Regel soll verhindern, dass solche Produkte mit einem Gesundheitsversprechen beworben werden können. Diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Verbraucher (Gramm ist wichtig) und dem gesetzlichen Standard (Prozentanteil der Energie ist wichtig) macht den Fall so knifflig.
4. Schutz vor Information? Das Dilemma der Verbraucheraufklärung
Warum aber gibt es eine so scheinbar widersinnige Regel, die es verbietet, eine korrekte, faktische Information wie die Proteinmenge zu wiederholen? Die Antwort findet sich in der Begründung des EU-Gesetzgebers (dem Erwägungsgrund 41 der LMIV) und lässt sich als eine Art „informierter Paternalismus“ beschreiben. Das Ziel ist, Verbraucher davor zu schützen, durch ein „Best-of“ an selektiv ausgewählten, positiven Nährstoffen auf der Verpackungsvorderseite abgelenkt zu werden.
Die beabsichtigte Wirkung der strengen Regelung ist es, den Verbraucher zur vollständigen, objektiven Nährwertdeklaration – also der Tabelle, meist auf der Rückseite – zu leiten. Die Sorge ist, dass ein prominenter „14g Protein“-Hinweis einen „Gesundheitsschein“ (Health Halo) erzeugt, der den Blick auf weniger vorteilhafte Werte wie einen hohen Zuckergehalt verstellt. Hier zeigt sich die zentrale Spannung im Verbraucherschutz: Unterschätzt dieser Ansatz die Mündigkeit moderner Verbraucher und enthält ihnen nützliche Fakten vor? Oder ist es ein notwendiger Mechanismus, um eine ganzheitliche und ehrliche Kaufentscheidung zu fördern?
Fazit: Mehr als nur ein Milchreisbecher
Der Fall der „14g“-Angabe offenbart die fundamentale Spannung im Herzen des EU-Lebensmittelrechts: Die Health-Claims-Verordnung will es Unternehmen erlauben, positive Eigenschaften hervorzuheben, während die Lebensmittelinformationsverordnung eine ganzheitliche Betrachtung erzwingen will, indem sie solche punktuellen Hervorhebungen einschränkt. Die Entscheidung des EuGH wird nicht nur das Schicksal von Protein-Claims besiegeln; sie wird einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie künftig jede Angabe von „wenig Zucker“, „reich an Ballaststoffen“ oder „Omega-3-Quelle“ auf Verpackungen kommuniziert werden darf.
Wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen, worauf werden Sie achten: auf die großen Werbeversprechen vorne oder die kleine Nährwerttabelle hinten? Und was ist Ihnen als Verbraucher wirklich lieber – eine schnelle, isolierte Information oder das komplette, ungeschönte Bild?
FAQ – Häufig gestellte Fragen zum Protein-Krimi
Worum ging es in dem BGH-Beschluss I ZR 2/25 vom 20. November 2025?
Der Beschluss betraf die rechtliche Zulässigkeit der gleichzeitigen Verwendung der nährwertbezogenen Angabe „HIGH PROTEIN“ und der konkreten Gramm-Angabe „14G PROTEIN“ auf einer Milchreis-Verpackung. Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) Fragen zur Auslegung der Health-Claims-Verordnung (HCVO) und der Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) vorgelegt. Es geht zentral um die Frage, ob die Gramm-Angabe als zulässige Konkretisierung der nährwertbezogenen Angabe gelten kann, obwohl sie in der LMIV nicht zur Wiederholung vorgesehen ist.
Welche europäischen Verordnungen stehen im Zentrum des Rechtsstreits?
Zentral sind die Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 (Health-Claims-Verordnung – HCVO), die die Zulässigkeit nährwert- und gesundheitsbezogener Angaben regelt, sowie die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung – LMIV), welche die verpflichtende Nährwertdeklaration festlegt. Der BGH muss klären, ob die HCVO-Bestimmungen zum Vorrang vor dem Wiederholungsverbot des Art. 30 Abs. 3 LMIV führen.
Welche konkrete Kennzeichnung führte zu dem Rechtsstreit?
Gestritten wurde über die Kennzeichnung eines Milchreis-Fertigprodukts. Auf der Deckelfolie und dem Seitenetikett waren unterhalb der Produktbezeichnung „Milch Reis“ die Angabe „HIGH PROTEIN“ sowie die ergänzende Angabe „14G PROTEIN“ (oder „14g PROTEIN pro Becher“) angebracht. Die Klägerin (Wettbewerbszentrale) beanstandete die isolierte Angabe der Proteinmenge in Gramm.
Warum hält die Klägerin die isolierte Angabe der Proteinmenge für unzulässig?
Die Klägerin stützt sich auf Art. 30 Abs. 3 LMIV, der eine abschließende Regelung zur Wiederholung von Nährwertangaben trifft. Danach dürfen nur bestimmte Angaben wie Brennwert, Fett, Zucker und Salz isoliert wiederholt werden, nicht jedoch Eiweiß (Protein). Die isolierte wiederholte Angabe von Eiweiß stellt nach dieser Auslegung einen Verstoß gegen die Marktverhaltensregelung des Art. 30 Abs. 3 LMIV dar.
Wie wird Art. 30 Abs. 3 LMIV vom BGH interpretiert und welche Absicht verfolgt er?
Der BGH geht davon aus, dass Art. 30 Abs. 3 LMIV als Verbot der wiederholten isolierten Angabe einzelner Nährstoffe auszulegen ist, die nicht explizit genannt sind. Ziel des Unionsverordnungsgebers war es, Verwirrung beim Verbraucher durch die freie Wahl erneut zu erteilender Informationen zu vermeiden und festzulegen, welche Informationen wiederholt werden dürfen.
Wie begründet die beklagte Lebensmittelherstellerin die Zulässigkeit der Grammangabe?
Die Beklagte argumentiert, die Angabe „14G PROTEIN“ sei eine nach der Health-Claims-Verordnung (HCVO) erlaubte Konkretisierung der zulässigen nährwertbezogenen Angabe „HIGH PROTEIN“. Sie geht davon aus, dass die spezielleren Regelungen der HCVO die Vorschriften der LMIV, insbesondere das Wiederholungsverbot, verdrängen, sofern die Angabe nach HCVO erlaubt ist.
Was sind die Bedingungen der HCVO für die Angabe "Hoher Proteingehalt"?
Laut Anhang zu Art. 8 Abs. 1 HCVO ist die Angabe, ein Lebensmittel habe einen hohen Proteingehalt, nur zulässig, wenn der Proteinanteil mindestens 20 % des gesamten Brennwerts des Lebensmittels ausmacht. Die bloße Angabe der absoluten Grammmenge pro Portion ist dabei nicht die Bedingung, sondern die relative Menge im Verhältnis zum Brennwert.
Was ist die erste zentrale Vorlagefrage, die der BGH dem EuGH zur Klärung vorlegt?
Die erste Frage (Vorlagefrage 1) zielt darauf ab, ob eine zulässige nährwertbezogene Angabe gemäß Art. 8 Abs. 1 HCVO durch eine objektiv zutreffende Aussage ergänzt werden darf, wenn diese aus Sicht des Verbrauchers eine Konkretisierung der nährwertbezogenen Angabe darstellt. Dies ist entscheidend, um festzustellen, ob die Grammangabe überhaupt unter die HCVO fallen kann.
Was ist die zweite zentrale Vorlagefrage, die der BGH dem EuGH zur Klärung vorlegt?
Die zweite Frage (Vorlagefrage 2) knüpft an die erste an und fragt, falls Konkretisierungen zulässig sind: Muss der Inhalt der konkretisierenden Aussage den Bedingungen des HCVO-Anhangs für die Verwendung der nährwertbezogenen Angabe entsprechen? Die Antwort klärt, ob die Grammmenge, die nicht die 20 %-Brennwert-Bedingung erfüllt, rechtlich haltbar ist.
Warum könnte die isolierte Grammangabe (14G Protein) aus Sicht des Verbraucherschutzes problematisch sein?
Die isolierte Angabe könnte dem Zweck der ausgewogenen Ernährung, den sowohl LMIV als auch HCVO verfolgen, widersprechen. Der Gesetzgeber sieht das Verhältnis des Proteins zum Gesamtbrennwert als maßgeblich an. Die Angabe der absoluten Grammmenge könnte beim Verbraucher den unzutreffenden Eindruck erwecken, die absolute Proteinmenge sei für die Höhe des Proteingehalts von Bedeutung, was als normative Irreführung gewertet werden könnte.
Wichtige Suchbegriffe & Keywords
Bundesgerichtshof (BGH) | Beschluss | I ZR 2/25 | Vorabentscheidung | Gerichtshof der Europäischen Union | Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 | Health-Claims-Verordnung (HCVO) | Art. 8 Abs. 1 HCVO | Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 | Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) | nährwertbezogene Angaben | gesundheitsbezogene Angaben | Anhang zu Art. 8 Abs. 1 HCVO | Art. 30 Abs. 3 LMIV | Art. 34 Abs. 1 LMIV | Eiweiß | Protein | HIGH PROTEIN | 14G PROTEIN | Milch Reis | Nährwertdeklaration | verpflichtende Nährwertdeklaration | Konkretisierung | objektiv zutreffende Aussage | zulässige nährwertbezogene Angabe | Ergänzung | Verbot der wiederholten Angabe | Grammmenge | Brennwert | Kohlenhydrate | Zucker | Fett | Salz | Nährstoff | UWG | Unlauterkeit | Marktverhaltensregelungen | Lebensmittelherstellerin | Deckelfolie | Seitenetikett | Verbraucher | Kaufentscheidung | Auslegung | Spezialitätsverhältnis | OLG München | LG München I | Revision | Ausgewogene Ernährung | Erwägungsgrund 41 LMIV | Proteinanteil (am Brennwert) | Abmahnkosten | Koch | Feddersen